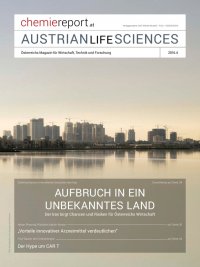
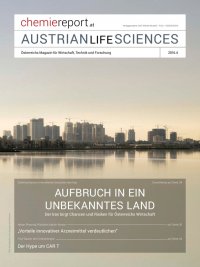
55 AustrianLifeSciences chemiereport.at 2016.4 CHEMIE & TECHNIK Bild: Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Hans Mol (RIKILT) suchungen über die experimentelle Variabilität der Identi- fizierungskriterien Retentionszeit und Ionenverhältnis durch- geführt. Die aufschlussreichsten Ergebnisse der umfassenden Pestizid-Analysen mit rund 135.000 Ionen-Chromatogrammen (1 ) und Vergleichsmessungen mit über 4000 Mykotoxin-Matrix-Kon- zentrations-Kombinationen (2 ) auf fünf verschiedenen Gerä- tesystemen sollen hier kurz zusammengefasst werden. Bezugsbasis für Ionenverhältnisse Auf welchen Referenzwert für das Ionenverhältnis sollte man sich in der Praxis beziehen? Auf jenen von Kalibrierstan- dards in reinem Lösungsmittel oder doch besser auf Matrix-ba- sierende Ratios von praxisnahen (dotierten) Proben? Die Erfah- rung zeigt, dass es hin und wieder vorkommt, dass die Matrix bei einem der MRM-Übergänge zu Interferenzen führen kann. Dadurch würde bei der vermeintlich praxisnäheren Proben-ba- sierten Version eine Verschiebung der Soll-Ratios auftreten, die noch dazu abhängig von der Konzentration des Zielanalyten ist. Die Matrix induziert aber meist einen konstanten Beitrag, des- sen Auswirkung sich mit steigender Analytkonzentration folg- lich, relativ gesehen, verringert. Werden Proben einer anderen Zusammensetzung oder auch nur unterschiedlicher Konzentra- tionen damit verglichen, werden falsch-negative Entscheidun- gen wahrscheinlicher. Es ist somit empfehlenswert für die Festlegung der MRM-Ver- hältnisse, den Mittelwert über alle reinen Kalibrierstandards derselben Sequenz heranzuziehen. Damit ist auch gewährleistet, dass deren Signalstärken (Signal/Noise, S/N) ausreichend hoch und innerhalb des dynamischen Bereiches sind. Die Ion Ratios eines bestimmten Überganges einer Verbin- dung können zwischen verschiedenen Geräten bzw. Typen bei manchen Verbindungen sehr ähnlich sein und bei anderen wiederum stark differieren. Selbst bei einer ganz bestimmten MS/MS-Anlage können sich die Ionenverhältnisse im längeren Zeitverlauf ändern, besonders aber kommt es bei Wartungen, bei jedem neuen Tuning und auch durch Massenachsen-Kali- brierungen zu Veränderungen des Quotienten. Innerhalb einer Sequenz sind die Ion Ratios von Kalibrierstandards aber gene- rell recht stabil und auch unabhängig von der Konzentration der Kalibrierstandards. Abweichungstoleranzen von Ionenverhältnissen Bei vielen Regulatorien beziehen sich die Abweichungstole- ranzen der MRM-Verhältnisse auf die relative Intensität der bei- den Produkt-Ionen zueinander. Bei der Regelung „2002/657/EC“ zum Beispiel wird im Intensitätsbereich zwischen 50 und 100 % eine Toleranz von ±20 % eingeräumt, liegt die Intensität unter 10 %, gilt eine viel höhere Toleranz von ±50 % (Bild 2 ). Diese Regelung geht davon aus, dass es einen Zusammen- hang zwischen der auftretenden Abweichung und dem relativen Intensitätsverhältnis der MRM-Übergänge gibt. Wie die expe- rimentellen Messungen in Bild 2 allerdings ergeben haben, ist diese angenommene Abhängigkeit nicht gegeben und sie konnte auf keinem der fünf Geräte bestätigt werden. Vielmehr liegt der Schluss nahe, dass die absolute Signalhöhe den Haupteinfluss auf die Schwankungen der Ion Ratios ausübt. Da starke Signale natürlich viel stabiler sind als verrauschte Messungen nahe der Nachweisgrenze, erscheint dieser Zusam- menhang mehr als plausibel. Plottet man die relative Abwei- chung des MRM-Signalverhältnisses gegen die Fläche des kleine- ren Produkt-Ions, bestätigt sich, dass die MS-Signalstärke (Response) der dominierende Faktor bei der Ion Ratio-Abwei- chung ist (Bild 3 ). Bei guten Signalqualitäten beider Übergänge ist das MRM-Verhältnis sehr stabil, und zwar unabhängig vom Intensitätsverhältnis der Übergänge und die Signalverhält- nis-Abweichungen sind dann auch relativ gering. Im Gegensatz zu bestimmten Vorgaben (USDA PDP), welche die Signalverhält- nis-Toleranz als Absolutwert definieren, müssen Ion Ratio-Tole- ranzen als Relativwerte in Prozent definiert werden. Besonders bei Realproben (blaue Punkte in Bild 2 und 3 ) werden die Ion Ratio-Abweichungen vom Signal/Rausch-Verhält- nis (S/N) der Ionenspuren dominiert. So waren rund 80 % der Verhältnis-Differenzen innerhalb der ±20 %-Grenze zu finden (Tabelle in Bild 3 ). Weniger als 2 % wiesen Abweichungen von über 50 % auf, diese jedoch allesamt im Bereich der sehr kleinen Peaks mit niedrigen S/N. Grundsätzlich darf die Bedeutung der Auswahl von möglichst selektiven bzw. spezifischen Ionen nicht unterschätzt werden. Precursor-Ionen unter 100 Da und MRM-Fragmente, die durch Abspaltung von Wasser oder gemeinsamen Gruppen entstehen, sind ungeeignet. Für die 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 Abweichung der Ion Ratios vom Soll (Durchschnitt aller LM-Standards) > 2000 Mykotoxin / Matrix / Konzentrations -Kombinationen 5 versch. LC-QQQ Systeme Relative Intensität der Ion Rations (niedrig/hoch) Relative Intensität der Ion Ratios > 50 % > 20 % to 50 % > 10 % to 20 % ≤ 10 % Toleranz lt. 2002/657/EC ± 20 % ± 25 % ± 30 % ± 50 % matrix solvent - - - 2 Plot der relativen Abweichungen der Signalverhältnisse gegen deren relative Intensitäten. Die farbig markierten Tole- ranzbereiche einer langjährigen EU-Rege- lung zeigen auf, dass die tatsächlichen Abweichungen nicht wie angenommen mit steigender relativer Intensität absin- ken (links nach rechts). 0.000.200.400.600.801.00